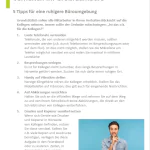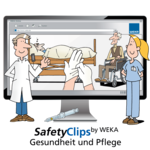Wie Sie den Schallschutz im Büro verbessern
Wer für die Gestaltung von Büroräumen verantwortlich ist – sei es als Sicherheitsfachkraft, Facility Manager oder Geschäftsleitung – steht vor der Aufgabe, ein produktives und gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen. Ein gezielter Schallschutz im Büro ist dabei kein Luxus, sondern ein wirksames Mittel, um Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einfachen Maßnahmen die Akustik in Büroräumen spürbar verbessern können – inklusive konkreter Tipps: vom Loungesofa bis zum Vorhang für besseren Schallschutz im Büro.
Zuletzt aktualisiert am: 9. Juli 2025

Warum ist Schallschutz im Büro wichtig?
Drucker surren, Telefone klingeln, Kolleginnen und Kollegen führen Gespräche – in vielen Büros gehört eine gewisse Geräuschkulisse zum Alltag. Was banal wirkt, hat handfeste Auswirkungen: Lärm am Arbeitsplatz mindert die Konzentration; die psychische Belastung durch Lärm kann langfristig krank machen. Gerade in Großraumbüros oder offen gestalteten Arbeitsbereichen stellt der Schallschutz im Büro eine oft unterschätzte Herausforderung dar. Je komplexer die Aufgabe, desto störender wirkt sich Lärm aus.
Deshalb gilt: Wer in den Schallschutz im Büro investiert, verbessert nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern stärkt auch die Effizienz seines Unternehmens. Ein ruhiges, konzentriertes Arbeitsumfeld wirkt sich positiv auf das Betriebsklima, die Mitarbeiterbindung und die Außenwirkung des Unternehmens aus.
Rechtliche Anforderungen und Empfehlungen zum Schallschutz im Büro
Gemäß den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A3.7 „Lärm“) muss der Geräuschpegel in Büroräumen so gering gehalten werden, dass eine gesundheitsgerechte und störungsfreie Arbeit möglich ist. Arbeitgeber sind gemäß § 3 ArbSchG verpflichtet, Risiken – einschließlich Lärm – systematisch zu bewerten und zu minimieren. Ein angemessener Schallschutz im Büro ist daher nicht nur empfehlenswert, sondern Teil der gesetzlichen Fürsorgepflicht.
Typische Lärmquellen im Büro
Um den Schallschutz gezielt planen zu können, ist es wichtig, die Lärmquellen im Büro zu identifizieren. Denn nicht nur Lautstärke, sondern auch die Art und Struktur des Geräuschs beeinflussen das Störempfinden.
- Gespräche und Telefonate: Eine der häufigsten Störquellen im Büro sind Gespräche. Besonders problematisch sind verständliche Sprachanteile („intelligibler Schall“), da das menschliche Gehirn automatisch versucht, Inhalte zu entschlüsseln – selbst wenn sie nicht relevant sind.
- Bürogeräte und Technik: Drucker, Scanner, Klimaanlagen oder Kaffeemaschinen erzeugen konstante oder impulsartige Geräusche, die in ihrer Summe zur Dauerbelastung werden können.
- Raumakustik und Nachhall: In vielen Büros wird der Lärm durch harte Oberflächen wie Glas, Beton oder glatte Möbel reflektiert. Das führt zu starkem Nachhall und verstärkt die Geräuschkulisse.
- Unterschied Großraumbüro vs. Einzelbüro: Während im Einzelbüro vor allem technische Geräusche dominieren, sind es im Großraumbüro die Mischung aus Gesprächen, Laufwegen und Nachhall, die das Lärmerleben prägen. Hier sind gezielte akustische Maßnahmen besonders dringlich.
Effektive Maßnahmen für besseren Schallschutz im Büro
Ein gutes Schallschutzkonzept im Büro basiert auf dem Zusammenspiel verschiedener Elemente – bauliche Gegebenheiten, Möblierung, Raumaufteilung und Materialien. Je nach Ausgangssituation lassen sich mit gezielten Maßnahmen schnell spürbare Verbesserungen erzielen. Für einen effizienten Schallschutz im Büro ist es natürlich sinnvoll, bei allen baulichen Maßnahmen im Büro schallmindernde Maßnahmen von vornherein mitzudenken und einzuplanen.
1. Schallabsorber gezielt einsetzen
Oberflächen spielen eine zentrale Rolle für die Raumakustik. Glatte Wände, Glasfronten oder nackte Böden reflektieren Schall und verstärken Nachhall. Abhilfe schaffen:
- Akustikdecken und schallabsorbierende Wandpaneele: Sie mindern die Schallreflexion an Oberflächen, indem sie die Schallenergie teilweise in Wärme umwandeln:
- Teppichböden statt harter Beläge
- Akustikbilder oder Filzmodule als dekorative Schallfänger
Diese Elemente reduzieren die Nachhallzeit und verbessern das Sprachverständnis – insbesondere in Besprechungsräumen oder offenen Arbeitsbereichen.
2. Möbel zur Schallabsorption nutzen
Auch Einrichtungsgegenstände lassen sich akustisch optimieren. Hohe Regale mit Rückwand, gepolsterte Sitzmöbel und Raumteiler mit schalldämpfender Oberfläche dienen nicht nur der Strukturierung, sondern auch dem Lärmschutz.
- Trennwände zwischen Arbeitsplätzen senken den Direktschall
- Akustik-Sofas oder Rückzugszonen bieten stille Arbeitsbereiche
- Große Loungemöbel ermöglichen nicht nur erholsame Pausen und angenehme Besprechungen. Sie absorbieren auch Schall.
3. Raumstruktur und Arbeitszonen clever planen
Die Anordnung von Arbeitsplätzen wirkt sich maßgeblich auf die Akustik aus. Idealerweise werden ruhige Tätigkeiten räumlich getrennt von Kommunikationszonen wie Druckerinseln, Teeküchen oder Meeting-Bereichen.
4. Schall- und Trennwände anbringen
Sind Wände z.B. schon durch Einbauschränke belegt, können diese mit schallabsorbierenden Schichten und Vliesen versehen werden. In größeren Büroeinheiten helfen oft mobile Trennwände, die Schallwirkung zu reduzieren. Sie können auch transparent ausgeführt werden, um weiterhin das Tageslicht nutzen zu können.
Der Vorteil von mobilen Trennwänden ist ihre variable Nutzung. Die Beschäftigten können die mobilen Trennwände wie gewünscht einsetzen und sich individuell vor Lärm schützen.
5. Fensterflächen nicht vergessen
Beim Thema Schallschutz im Büro werden die Fenster häufig übersehen, obwohl sie hinsichtlich der Schalleigenschaften von Räumen eine beachtliche Wirkung haben. Insbesondere große Fensterfronten reflektieren den Schall. Hier kann mikroperforierte Alufolie, die in geeignetem Abstand zur Glasfläche angebracht wird, Abhilfe schaffen.
6. Schallschutzvorhänge als flexible Lösung
Insbesondere bei nachträglichen Maßnahmen bieten schallschluckende Vorhänge eine schnelle, kosteneffiziente und wirksame Lösung. Sie lassen sich vor Glasflächen, Türen oder als Raumtrenner einsetzen – mehr dazu im nächsten Abschnitt.
Vorhang als Schallschutz im Büro: Vorteile und Einsatzbereiche
Wenn bauliche Veränderungen zu aufwendig oder kostspielig sind, bieten schallschluckende Vorhänge eine flexible und effektive Alternative. Sie sind flexibel verschiebbar und kosteneffizient. Spezielle Akustikvorhänge reduzieren den Nachhall, dämpfen Störgeräusche und schaffen diskrete Arbeitsbereiche – ganz ohne Umbauten.
Wie funktionieren Schallschutzvorhänge?
Anders als herkömmliche Gardinen bestehen Schallschutzvorhänge aus mehrlagigen, dicht gewebten Stoffen mit hoher Flächenmasse. Diese Materialien absorbieren Schallwellen, anstatt sie zurück in den Raum zu reflektieren. Besonders wirksam sind Vorhänge mit:
- hoher Stoffdichte (mind. 300–400 g/m²),
- flächendeckendem Faltenwurf (mind. 2-facher Stoffeinsatz),
- Boden- und Deckenmontage zur Minimierung von Schallleckagen.
Je nach Einsatzgebiet können Akustikvorhänge den Nachhall um bis zu 60 % reduzieren.
Einen Vorhang als Schallschutz im Büro können Sie einsetzen:
- vor Fenstern: Große Glasflächen reflektieren Schall stark. Ein Akustikvorhang verbessert nicht nur die Raumakustik, sondern schützt auch vor Blendung und Hitze.
- als Raumtrenner: In Großraumbüros oder flexiblen Arbeitswelten lassen sich mit Vorhängen temporäre Ruhezonen, Besprechungsbereiche oder Rückzugsräume schaffen – ohne feste Wände.
- an Türen oder Durchgängen: Akustikvorhänge können den Direktschall zwischen Räumen dämpfen, etwa bei viel begangenen Fluren oder offenen Eingangsbereichen.
- in Besprechungsräumen: Auch Meetingräume profitieren von Vorhängen – sie verbessern das Sprachverständnis und die Konzentration, besonders bei längeren Besprechungen oder Videokonferenzen.
Umsetzung im Büro: Schallschutz- und andere Maßnahmen kombinieren
Ein wirkungsvoller Schallschutz im Büro entsteht selten durch eine Einzelmaßnahme. Vielmehr führt die gezielte Kombination verschiedener Elemente zum besten Ergebnis – abgestimmt auf Raumnutzung, Mitarbeiterstruktur und akustische Anforderungen.
1. Akustik ganzheitlich betrachten
Bevor Maßnahmen umgesetzt werden, empfiehlt sich eine systematische Akustikanalyse. Diese erfasst Nachhallzeiten, Lärmquellen und die Sprachverständlichkeit im Raum. Je nach Komplexität kann dies durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, eine externe Beratung oder mit mobilen Akustikmessgeräten erfolgen.
2. Maßnahmen sinnvoll kombinieren
Einzelne Elemente entfalten ihre volle Wirkung erst im Zusammenspiel. Beispiele für effektive Kombinationen:
- Akustikdecke + schallschluckender Bodenbelag + Vorhänge
- Trennwände zwischen Arbeitsplätzen + Akustikbilder an den Wänden
- Raumzonierung + Akustikvorhänge als flexible Trennung
Solche Kombinationen reduzieren sowohl Direktschall als auch Nachhall – zwei zentrale Faktoren für gutes Hören und Verstehen.
3. Schallschutz mit anderen Anforderungen abstimmen
Akustikmaßnahmen sollten nicht isoliert betrachtet werden. Achten Sie darauf, dass Schallschutzlösungen mit weiteren Anforderungen vereinbar sind, etwa:
- Brandschutz (z. B. schwer entflammbare Materialien)
- Lichtführung und Tageslichteinfall
- Lüftungskonzepte
- Barrierefreiheit und Fluchtwege
Vorhänge bieten hier oft Vorteile, da sie sich flexibel anpassen und leicht demontieren lassen.
4. Wirtschaftlichkeit prüfen & fördern lassen
Guter Schallschutz muss nicht teuer sein. Viele Maßnahmen lassen sich auch mit begrenztem Budget umsetzen – insbesondere, wenn bestehende Strukturen genutzt oder nachgerüstet werden.
Tipp:
In einigen Bundesländern oder Branchen gibt es Förderprogramme für gesundheitsfördernde Arbeitsplätze, in deren Rahmen auch Akustikmaßnahmen bezuschusst werden können.
Wohlbefinden im Büro durch Schallschutz steigern
Ein durchdachter Schallschutz im Büro ist kein „Nice-to-have“, sondern ein zentraler Faktor für konzentriertes Arbeiten, gesunde Mitarbeitende und reibungslose Kommunikation. Gerade in offenen Bürostrukturen kann Lärm zur echten Belastung werden – mit negativen Folgen für Produktivität, Motivation und Teamklima.
Die gute Nachricht: Bereits mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen wie schallabsorbierenden Materialien, intelligenten Raumlösungen und dem Einsatz von Schallschutzvorhängen lässt sich die akustische Qualität spürbar verbessern.
Für Verantwortliche im Arbeitsschutz, in der Büroplanung oder im Facility Management heißt das: Wer frühzeitig in akustische Maßnahmen investiert, schützt nicht nur Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden – sondern stärkt auch die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber.